
Von Greg
Liebhaber guter Weine und Kuriositäten.
26/09/2025
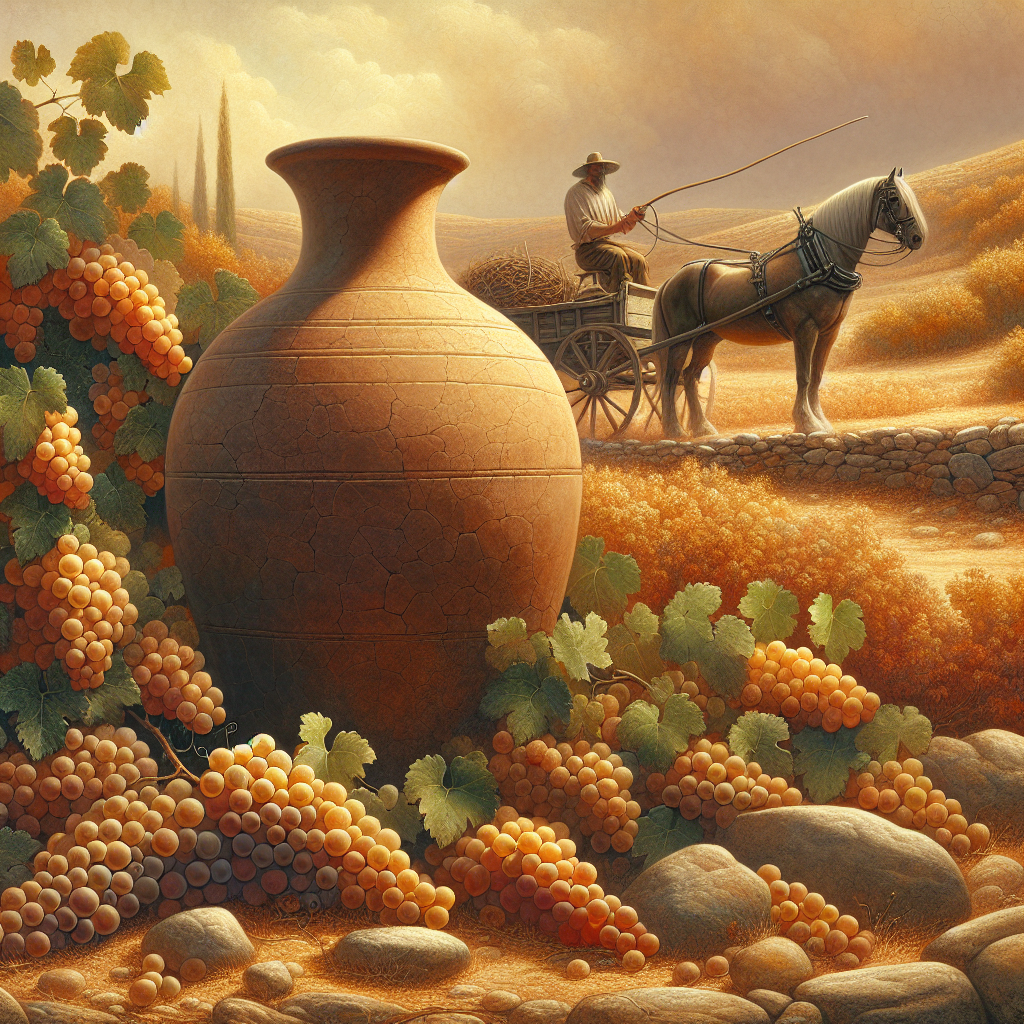

Von Greg
Liebhaber guter Weine und Kuriositäten.
26/09/2025
Und wenn die Zukunft des Weins einen Hauch von einst trüge ? Im Weinberg wie im Keller überdauern sehr alte Handgriffe, bisweilen von Winzerinnen und Winzern, die sich Zeit nehmen, neu belebt. Vom Fuß in den Trauben bis zu eingegrabenen Amphoren: Diese Traditionen sind keine nostalgischen Marotten : Sie erzählen von einer anderen Vorstellung von Geschmack und Landschaft.
Man vergisst es leicht, doch die meisten großen Weine entstehen noch immer durch Handlese. Warum ? Weil eine Hand auswählt, sortiert und die Trauben respektvoll behandelt. Das ist langsamer, arbeitsintensiver, aber es verändert die Qualität des Leseguts.
Ein weiteres starkes Bild : das Treten der Trauben mit den Füßen. Im Douro steigt man in die breiten Granitbecken (die Lagares), um die Beeren behutsam zu zerquetschen. Der Fuß ist ein Werkzeug, das die Kerne nicht aufplatzen lässt und die Frucht klar bewahrt. In einigen Gütern gibt es diese fröhliche, rhythmische Szene noch.
Und dann ist da das Arbeitspferd, das zwischen den Reihen hindurchgeht. Es verdichtet die Böden weniger als ein Traktor und ermöglicht die Bearbeitung steiler oder schmaler Parzellen. Man sieht es im Burgund, in der Champagne, an der Loire – in Weinbergen, in denen der lebendige Boden ebenso zählt wie das Laub.
Die Gobelet-Erziehung, jene Stöcke, die wie kleine Kandelaber wachsen, bleibt in trockenen, windigen Klimaten König (Mittelmeerraum, Priorat, einige Parzellen von Châteauneuf-du-Pape). Wenig Draht, kurzer Schnitt, eine natürliche Wuchsform, die die Trauben vor der Sonne schützt.
Auch die Massenselektion kehrt zurück. Die Idee ist einfach : Man bepflanzt den Weinberg mit Edelreisern, die von alten, bewährten Parzellen entnommen wurden. Kein einzelner Klon, sondern eine Vielfalt an Stöcken, die Komplexität und Resilienz bringt. Ein kleiner Schatz an Anpassungsfähigkeit, der von Reihe zu Reihe weitergegeben wird.
An manchen Hängen praktiziert man noch die Komplantation, jene „gemischten» Parzellen, in denen mehrere Rebsorten zusammen stehen. Es wird alles auf einmal geerntet und gemeinsam vergoren : eine Cuvée schon im Weinberg, wie in Österreich (Gemischter Satz) oder in sehr alten Rebanlagen im Douro.
Die Amphore feiert ein Comeback, unter verschiedenen Namen : Qvevri in Georgien, Talha im Alentejo, Tinaja in Spanien. Eingegraben oder nicht – diese Tonkrüge lassen den Wein atmen, ohne ihn wie Holz zu aromatisieren. Ergebnis : saftige Rote, Weiße mit „uhrwerkartiger» Textur, teils mit Maischestandzeit auf den Schalen (die berühmten „Orangen»), für mehr Relief.
Im Keller setzen viele auch auf sehr große alte Fuder. Weniger Holzaromen, mehr Präzision der Frucht. Und bei den Gärungen bedeutet „indigene Hefen» schlicht, dass man jene arbeiten lässt, die auf den Trauben und im Keller leben. Mehr Risiken, aber oft mehr Persönlichkeit.
Auf den Etiketten verraten einige Hinweise diese Praktiken. Halten Sie die Augen offen :
Diese Worte garantieren keinen Stil, geben aber Hinweise auf die Philosophie des Weinguts.
Diese Traditionen sind keine Reliquien. Sie beantworten hochaktuelle Fragen : lebendige Böden, Vielfalt, Präzision des Geschmacks. Mein Rat ? Sprechen Sie mit Ihrer Weinhändlerin/Ihrem Weinhändler, verlangen Sie einen fußgestampften Wein, einen in Amphoren ausgebauten Weißwein, einen Roten von alten Reben in Gobelet-Erziehung. Kosten Sie die Gesten ebenso wie den Saft. Sie werden sehen : In manchen Gläsern hat die Zeit wirklich Geschmack.